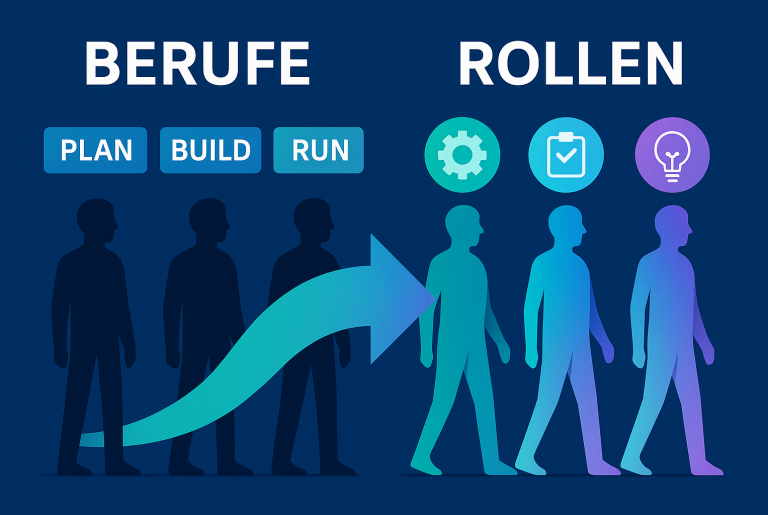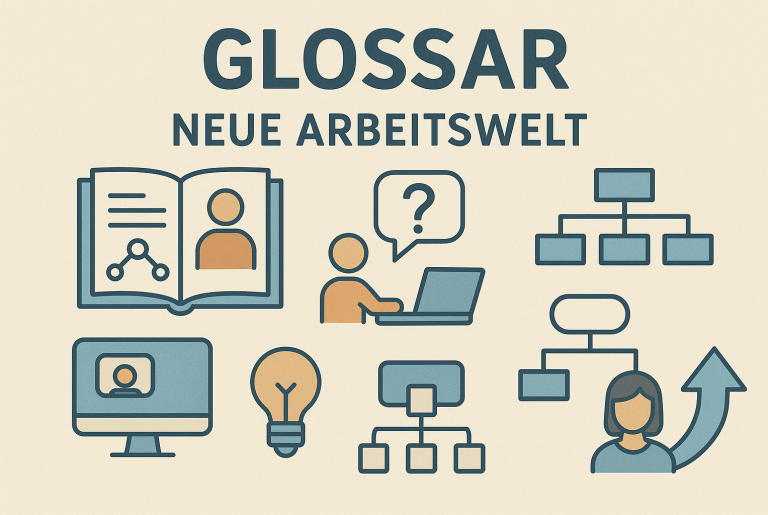29. Oktober 2025
ICT-Salärstudie 2025: Talente fair entlöhnen

Cornelia, die neuste Ausgabe der ICTSalärstudie ist da. Welche Akteur:innen profitieren besonders von der Studie?
Cornelia: Besonders KMU ziehen einen grossen Nutzen daraus. Sie liefert verlässliche Benchmarks, differenziert nach Unternehmensgrösse, Funktion und Kompetenzstufe, und ermöglicht so eine marktorientierte, transparente Entlöhnung. Entscheidend ist, dass viele Teilnehmende selbst aus dem KMU-Umfeld stammen. Nur so spiegeln die Reports die Realität dieses zentralen Pfeilers des Schweizer Arbeitsmarktes wider.
Was sind die ersten Erkenntnisse, die du mit uns teilen kannst?
Cornelia: Insgesamt liegt die Veränderung der Gesamtlohnsumme zum Vorjahr bei lediglich +0,4%. Spannender sind Verschiebungen in Altersgruppen, Funktionen und Senioritätsstufen. Die unter 30-jährigen verzeichnen mit 2% einen vergleichsweise deutlichen Saläranstieg. Bei den Berufen mit über 200 Nennungen verbucht der Junior Software Engineer mit 6% den grössten Salärzuwachs. Zudem konnten wir bei den Salären der Lernenden einen durchschnittlichen Anstieg von 3% verzeichnen. Das könnten Hinweise darauf sein, dass gerade junge Fachkräfte an Bedeutung gewinnen und von Unternehmen aufgrund ihres aktuellen Know-hows und ihrer frischen Perspektiven umworben werden.
Konrad, du beschäftigst dich schon seit Jahren mit Aspekten der Lohnpolitik aus forschender Perspektive. Welche Trends sind auf der Watchlist des Fachgebiets Compensation Management?
Konrad: Die Vergütung orientiert sich zunehmend an Kompetenzen (Skill-based Pay) statt an Positionen. Das ist teilweise auch erklärbar durch flachere Hierarchien in den Unternehmen. Es zählt vermehrt, was jemand kann und weniger, was jemand ist. In der Schweiz zahlen IT-Firmen öfter für zertifizierte Weiterbildungen (Upskilling, z. B. in Cloud, AI, Cybersecurity, etc.). Auf diese und andere Themen gehen wir auch im CAS Performance und Compensation Management der ZHAW ein, welcher im Februar 2026 beginnt.
Ein weiterer Trend ist die Individualisierung von Vergütungspaketen. Mitarbeitende können zum Beispiel aus verschiedenen Fringe Benefits wählen oder erhalten Zuschüsse fürs Homeoffice. Dies ist wenig erstaunlich, da wir diese stärkere Individualisierung auch in anderen Lebensbereichen sehen. Die Trends in den Vergütungspraktiken sind eine logische Folge davon.
Wie lässt sich Kompetenzorientierung denn messen? Welche Kompetenzen haben in den letzten Jahren an Wert gewonnen?
Konrad: An Bedeutung gewonnen haben Kompetenzen, welche sich (noch) schwer automatisieren lassen, wie digitale Kompetenzen und Digital Mindset, Selbstorganisation und Kreativität, sowie agilitätsbezogenes Know-how und fachübergreifende Handlungskompetenzen. Mit der Messung der Kompetenzorientierung tun sich viele Unternehmen aber noch schwer, unter anderem deshalb, weil sich Skills rasch verändern und ein gemeinsames Verständnis oft nicht vorhanden ist.
Lohntransparenz ist derzeit ein Thema, das stark polarisiert. Beim ersten #WORKITUP von swissICT gewährten Unternehmen Einblick in ihre Praxis. Wie ordnet ihr das ein?
Cornelia: Spannend war, dass wir am #WORKITUP Unternehmen kennengelernt haben, die Lohntransparenz seit Jahren konsequent leben und damit bewusst andere Wege gehen als die Mehrheit. Für mich ist das Teil eines grösseren Bildes rund um Arbeitgeberattraktivität. Ähnliche Themen greifen wir im Employment Conditions Report auf: vom Mutter- und Vaterschaftsurlaub über Workation bis hin zu Homeoffice-Regelungen. Die Ergebnisse zeigen, dass solche Benefits im Wettbewerb um Talente entscheidend sein können.
Konrad: Tatsächlich ist die Frage der Lohntransparenz sehr aktuell. Mit ein Grund dafür sind verschiedene Transparenzinitiativen. In der Europäischen Union ist 2023 eine EU-Richtlinie zur Entgelt transparenz in Kraft getreten, welche bis zum 7. Juni 2026 umgesetzt werden muss. Man erhofft sich damit u. a. weniger Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt. Für die Schweiz relevant ist Logib, welche die Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern überprüft und seit dem 1. Juli 2020 für Firmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden gesetzlich vorgeschrieben ist.
Wenn wir über Lohntransparenz sprechen: Wie definiert die Wissenschaft faire Vergütung?
Konrad: Die Wissenschaft unterscheidet oft zwischen der prozeduralen Lohntransparenz (Offenlegung der Kriterien und Prozesse, wie Saläre festgelegt und angepasst werden) und der distributiven Fairness. Erstere hat den stärksten positiven Einfluss auf Motivation und Vertrauen der Mitarbeitenden. Die distributive Lohntransparenz (Offenlegung der konkreten Lohnhöhe, z. B. Durchschnittslöhne pro Abteilung) hingegen wird als weniger relevant für die Motivation empfunden, kann aber zur Wahrnehmung von Fairness beitragen. Faire Vergütung ist jedoch nicht nur objektiv messbar, sondern ist stark von der Wahrnehmung der Mitarbeitenden abhängig. Als fair gelten Löhne dann, wenn die Kriterien nachvollziehbar sind, die Kommunikation offen erfolgt, und die Lohnverteilung als gerecht empfunden wird.